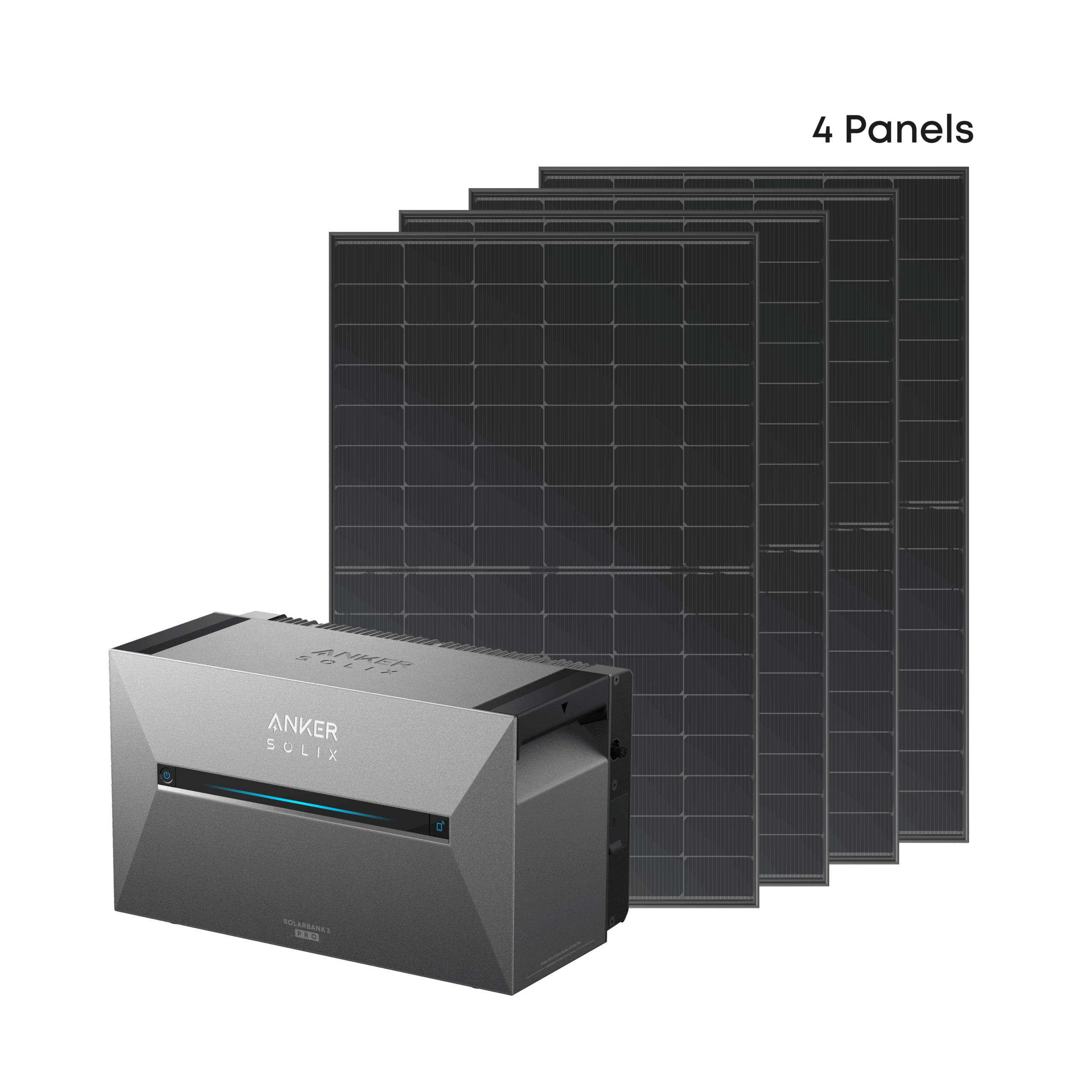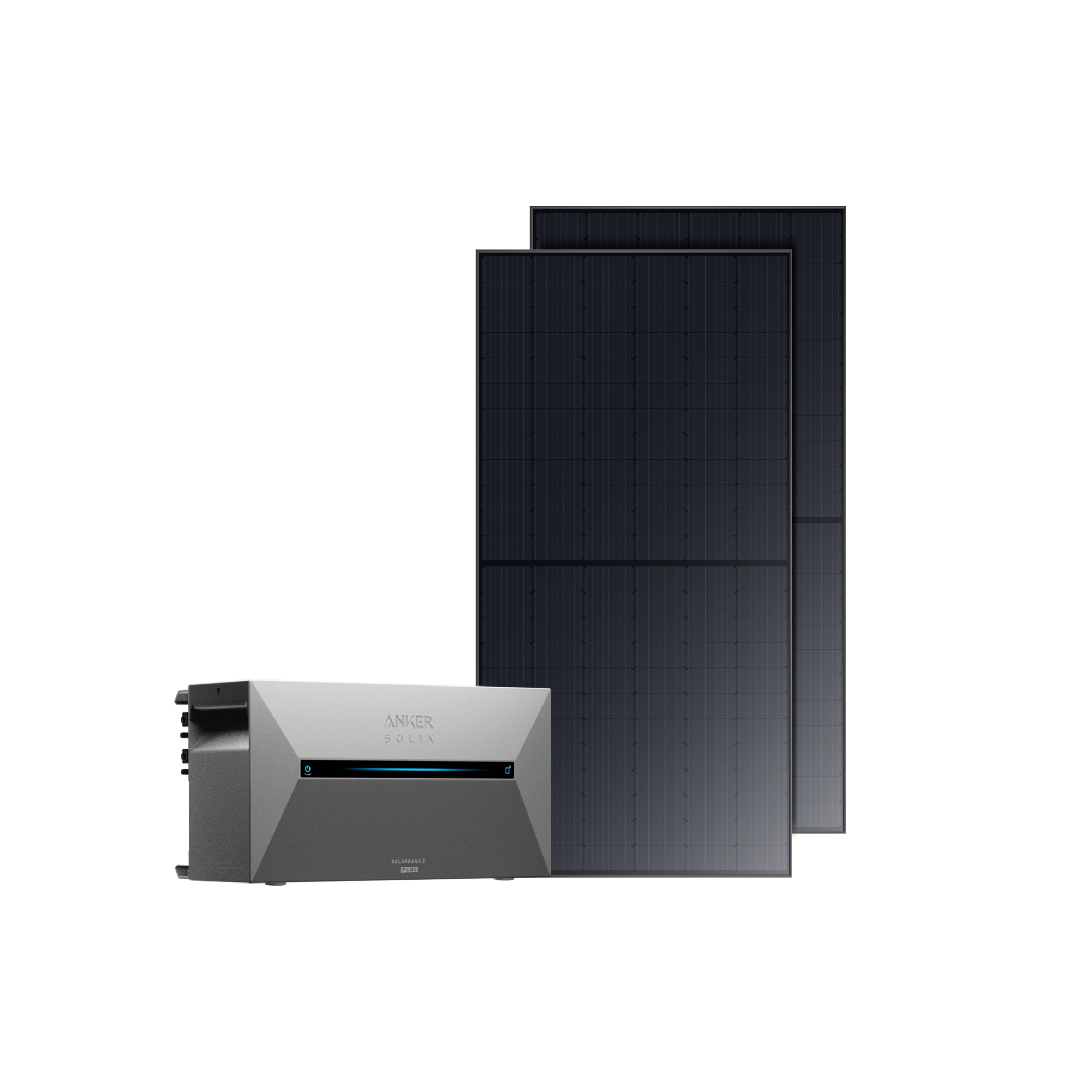Sonnensteuer für Balkonkraftwerke: Wie können sich Besitzer schützen?
Die geplante Sonnensteuer könnte nicht nur Besitzer großer PV-Anlagen treffen, sondern auch Betreiber von Balkonkraftwerken (Stecker-Solaranlagen). Viele Privathaushalte nutzen die kleinen Module, um Stromkosten zu sparen – doch falls eine Abgabe auf Eigenverbrauch kommt, könnte sich die Wirtschaftlichkeit verschlechtern.
Doch gibt es Möglichkeiten, sich als Balkonkraftwerk-Besitzer zu schützen? Und was sollten Interessenten beachten, die noch eine Anlage planen?
Wären Balkonkraftwerke von der Sonnensteuer betroffen?
Aktuell ist noch unklar, ob und wie stark Mini-PV-Anlagen besteuert werden sollen. Mögliche Szenarien:
- Befreiung für Kleinstanlagen (unter 600 Watt):
- Da Balkonkraftwerke meist nur 300–600 Watt Leistung haben, könnten sie ausgenommen werden.
- Ähnlich wie bei der bisherigen Regelung zur EEG-Umlage, die für kleine Anlagen nicht galt.
- Pauschale Abgabe pro kWh:
- Falls eine allgemeine Sonnensteuer kommt, könnten auch Mini-PV-Betreiber zahlen – z. B. 1–2 Cent pro selbst verbrauchter kWh.
- Bei einem typischen Jahresertrag von 300–600 kWh wären das 3–12 Euro pro Jahr – überschaubar, aber ein zusätzlicher Kostenfaktor.
- Registrierungs- oder Meldepflicht:
- Eventuell könnte eine Anmeldung beim Netzbetreiber Pflicht werden, um die Abgabe zu berechnen.
Wie können sich Balkonkraftwerk-Besitzer schützen?
Falls eine Steuer kommt, gibt es Strategien, um die Belastung zu minimieren:
Stromspeicher nutzen (ohne Einspeisung ins Netz)
- Viele Balkonkraftwerke speisen Überschussstrom automatisch ins Hausnetz ein.
- Falls dieser Strom besteuert wird, könnte ein kleiner Batteriespeicher helfen:
- Der Solarstrom wird zwischengespeichert und später verbraucht.
- Da nichts ins öffentliche Netz fließt, könnte die Abgabe umgangen werden.
- Nachteil: Speicher erhöhen die Anschaffungskosten (ab ~500 €).
Volleinspeisung vermeiden (keine Einspeiseregistrierung)
- Theoretisch müssen Balkonkraftwerke mit Einspeisung gemeldet werden.
- Wer keinen Strom ins Netz zurückspeist, könnte unter dem Radar bleiben.
- Achtung: Rechtlich ist unklar, ob das dauerhaft möglich ist.
Anlage vor Inkrafttreten installieren
- Falls Bestandsschutz gilt, könnten bereits angeschlossene Balkonkraftwerke verschont bleiben.
- Wer noch zögert, sollte eventuell schnell handeln.
Förderungen und Steuervorteile nutzen
- Einige Bundesländer (z. B. NRW, Berlin) fördern Balkonkraftwerke mit bis zu 500 €.
- Durch die Förderung gleicht man mögliche Steuerbelastungen aus.
Was sollten Neueinsteiger jetzt beachten?
Wer überlegt, sich ein Balkonkraftwerk anzuschaffen, sollte folgende Punkte prüfen:
Gerätewahl:
- Wechselrichter mit „Null-Einspeisung“ (z. B. Hoymiles HM-300/600) vermeiden Überschussstrom.
- Mit Speicherlösung (z. B. kleine Powerstation) kann man autarker werden.
Anmeldung:
- Aktuell müssen Balkonkraftwerke beim Netzbetreiber und Marktstammdatenregister gemeldet werden.
- Falls eine Steuer kommt, könnte eine nicht gemeldete Anlage steuerlich unattraktiv werden.
Wirtschaftlichkeit prüfen:
- Selbst mit einer kleinen Abgabe lohnt sich ein Balkonkraftwerk oft noch.
- Beispielrechnung:
- 600-Watt-Anlage (Erzeugung: 500 kWh/Jahr)
- Steuer (1 ct/kWh): 5 € pro Jahr
- Ersparnis (bei 30 ct/kWh): 150 € pro Jahr
- Amortisation: weiterhin in 3–5 Jahren möglich
Fazit: Lohnt sich ein Balkonkraftwerk trotz Sonnensteuer?
Ja, denn:
- Die mögliche Abgabe wäre gering (unter 15 €/Jahr).
- Die Stromkostenersparnis bleibt deutlich höher.
- Mit Speicherlösungen oder optimierter Steuerung lässt sich die Belastung minimieren.
Tipp für Interessenten:
- Jetzt noch schnell installieren, um möglichen neuen Regelungen zuvorzukommen.
- Auf qualitativ hochwertige Komponenten achten, um lange Nutzungsdauer zu sichern.
Was halten Sie von der Sonnensteuer für Balkonkraftwerke? Würden Sie trotzdem eine Anlage kaufen? Diskutieren Sie mit!